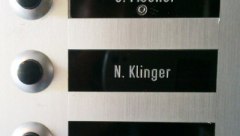Ja, ich tue es schon wieder. Auf leisen Sohlen schleich ich mich herein, blicke mich um. Niemand da, die Luft ist rein. Schnell breite ich meine Ware aus, bevor jemand kommt. Drei grosse Haufen, heute hab ich besonders viel Material. Ich öffne leise die Luke, stopfe die erste Ladung rein. Husch, husch, weiter, die zweite Fuhre, dann die dritte. Ich weiss, es ist nicht ganz sauber, aber heute wird schmutzige Wäsche gewaschen. Jetzt gibt es kein Zurück. Die Maschinerie ist angelaufen, nimmt ihren Gang. Es wird nur eine halbe Stunde dauern. Eh mich jemand erwischt, ist das Geschäft erledigt. Hoffe ich. Jetzt erst lasse ich meinen Blick über die Tabelle mit den fein säuberlich eingetragenen Daten gleiten: 2-Z-Whg, 5. Stock. Ich wohne im Zehnten. Ich bin ein Rebell, fast schon kriminell: Ich habe die Waschküche ausserhalb meines Waschtags belegt! „Lapalie“, höre ich euch verächtlich schnauben. Aber hört, Waschküchenstreit kann tödlich enden.
Ja, ich tue es schon wieder. Auf leisen Sohlen schleich ich mich herein, blicke mich um. Niemand da, die Luft ist rein. Schnell breite ich meine Ware aus, bevor jemand kommt. Drei grosse Haufen, heute hab ich besonders viel Material. Ich öffne leise die Luke, stopfe die erste Ladung rein. Husch, husch, weiter, die zweite Fuhre, dann die dritte. Ich weiss, es ist nicht ganz sauber, aber heute wird schmutzige Wäsche gewaschen. Jetzt gibt es kein Zurück. Die Maschinerie ist angelaufen, nimmt ihren Gang. Es wird nur eine halbe Stunde dauern. Eh mich jemand erwischt, ist das Geschäft erledigt. Hoffe ich. Jetzt erst lasse ich meinen Blick über die Tabelle mit den fein säuberlich eingetragenen Daten gleiten: 2-Z-Whg, 5. Stock. Ich wohne im Zehnten. Ich bin ein Rebell, fast schon kriminell: Ich habe die Waschküche ausserhalb meines Waschtags belegt! „Lapalie“, höre ich euch verächtlich schnauben. Aber hört, Waschküchenstreit kann tödlich enden.
„Die Saumore“, Oma Lisbeth schüttelt sich angewidert. „Die schmeisst die Essensreste einfach in den Hof. Das zieht doch die Ratten an!“. Oma Lisbeth hasst Ratten – sie hat eine Phobie und die Wohnung parterre. „Im Waschhaus hinterlässt die auch nur Dreck. Neulich hab ich Schrauben in der Maschine gefunden, Schrauben! Jetzt kannst dir mal vorstellen, wie die putzt“. Die Stimmung ist miserabel im 6-Familienhaus am Erlacherhof. „Die“, das ist die Nachbarin, Clémence Poletti. Eine Elsässerin. Nicht dass es relevant wäre, die Verständigungsschwierigkeiten übersteigen das Sprachliche. Poletti ist selten zu sehen, aber wenn sie mir begegnet, sehe ich aufgeschwemmte Gesichtszüge. „Alkoholiker“, flüstert man hinter vorgehaltener Hand, „alle beide, der Mann auch“. Man wohnt Tür an Tür, aus dem Weg gehen kann man sich nicht. Eines Morgens klopft es an eben dieser Tür. Lisbeths Mann Ruedi öffnet. Vor der Tür steht der alte Poletti, mit blutunterlaufenen Augen. Er hat eine Waffe in der Hand. Drückt ab. Ruedi geht nieder. Er ist getroffen, in der Schulter. Poletti wendet sich ab, geht breitbeinig die Treppe hinauf, gemächlich, er ist nicht mehr so fit, bis in den dritten Stock. Klopft wieder. In der Tür erscheint Beat K.. Beat, ein ruhiger, netter Mann, immer gut gelaunt. Er hat sich in den Streit nie eingemischt. Wieder zielt Poletti. Jetzt hat er Übung, trifft. Wir werden nie erfahren, was Beat in diesem Moment gedacht hat.
Einige Monate später klingelt es auch an meiner Türe, gefolgt von einem energischen Klopfen. Die Wäsche ist schon gewaschen, hängt an der Leine zum Trocknen. Vor mir steht bücklings die Huber vom vierten Stock. Sie ist unbewaffnet, bis auf ihren Stock, auf den sie sich jetzt stützt. Heute mein offizieller Waschtag. „Chöme sie emoll mit“, fordert sie bestimmt, „ich zeig ihne öbbis“. Ich folge ihr in den Keller. Ob sie mir den Stock über die Rübe ziehen wird? „Luege sie emoll, düen sie d’Chleider nid eifach so über d’Lyyne hängge. Nähme sie Chlämmerli!“. Und jetzt? Hab mich bis heute dem Chlämmerli-Diktat verweigert. Bin eben ein Rebell. Und heute, hier im Hause am Letzigraben, hat es eh keinen Trockenraum. Nur Tumbler. 2000-Watt-Gesellschaft ade, ich elende Stromverschwenderin. Asche auf mein Haupt.
* die Namen sind wie meistens und in heiklen Fällen immer frei erfunden.