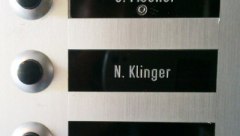Meine treue Begleiterin! Wie viele Stunden mögen wir wohl zusammen schweigend auf dem Sofa gehöckelt haben, fast wie zwei alte Bergpuurli auf dem Bänkli vor der Alphütte. Okay, du warst dabei jeweils etwas lauter als ich, denn dein röchelndes Schnaufen erinnerte irgendwie an einen Tiefseetaucher. Manche haben dich dafür auch ausgelacht, aber das war uns beiden egal. Nie bist du von meiner Seite gewichen, egal wie ausgelassen ich war oder wie beschissen es mir ging. Du hast unerträgliche Wartezeiten verkürzt, zermürbende Langweile zerstreut, meine flatternden Nerven beruhigt und vor allem: meinen Kummer betäubt. Überall warst du dabei, nur auf die Toilette hab ich dich nicht mitgenommen – Tag für Tag, treu wie eine Fussfessel, und das warst du ja irgendwie auch.
Ich erinnere mich gut, wie alles begann. Da warst du noch klein. Was haben wir gelacht, wenn uns im Ausgang jemand Feuer geben wollte, während du an meinen Lippen hingst. Im Verlaufe der Zeit bist du gewachsen, und je grösser du wurdest, desto mehr hast du gesoffen. Das ging einige Zeit gut, aber so gegen das Ende hin hast du immer öfter zu sabbern angefangen oder littest unter sonstwelchen Zipperlein. Es wurde langsam anstrengend, und trotzdem waren wir unzertrennlich. Mehr als einmal hast du meinen Puls durch die Decke gehen lassen, mit deiner leicht pyromanen Art: Einmal, da hast du meine Handtasche in Brand gesteckt – ich sah mich genötigt, den ganzen Inhalt auf den Boden zu schütten, direkt unter der Hardbrücke und den entsetzten Augen meiner Kollegin. Auch im Papiersaal, an dieser 80er-Party – «the heat is on» – mussten wir gewisse Teile von dir in einem Eiskübel versenken, weil du mal wieder mit einer Büroklammer geknutscht und dir dabei die Finger verbrannt hast. Ach ja, du warst eine Verführerin. Kaum jemand, den du nicht angemacht hättest, egal ob Männlein oder Weiblein. Ich weiss nicht mehr, wieviele Menschen dich «nur mal kurz» ausleihen wollten, und dich dann, nach einem deiner süssen Küsse, äusserst widerwillig wieder hergaben.
Am Ende hast du begonnen, dein eigenes Ding durchzuziehen. Neulich, als ich schon im Bett lag, wurde ich von einem Geräusch aufgeschreckt – dieses Keuchen, das ich zu gut kenne, das aber zu diesem Zeitpunkt gar nicht möglich hätte sein dürfen. Ich war mir erst nicht sicher, ob es ein Einbrecher, ein Geist oder Darth Vader persönlich sei, der da mit dir zugange ist. Als ich schliesslich aufstand und nachsah, ertappte ich dich – total erhitzt standest du in der Küche und tatest, als wär nichts gewesen. Dabei hattest du dort ganz offensichtlich eben noch geraucht. Von da an wurdest du mir langsam unheimlich.
Teure Freundin, du hast mir nicht immer gut getan, aber ich habe dich schmerzlich vermisst, wenn du nicht da warst, ja ich war süchtig nach dir. Du hast mir wohl viel gegeben, aber ebenso viel genommen: Zeit und Energie. Es war eine Hassliebe – meine Güte, ich ging sogar einmal mit dem Hammer auf dich los, nur um dich endlich loszuwerden. Vorbei. Jetzt ist es endgültig. Ich denke zwar noch immer ab und zu an dich – doch die Zeit ist reif für eine Trennung. Vor zwei Wochen habe ich dich nun in deine Einzelteile zerlegt, gesäubert und tief hinten im Schrank versteckt. Ruhe in Frieden, liebe E-Zigarette.